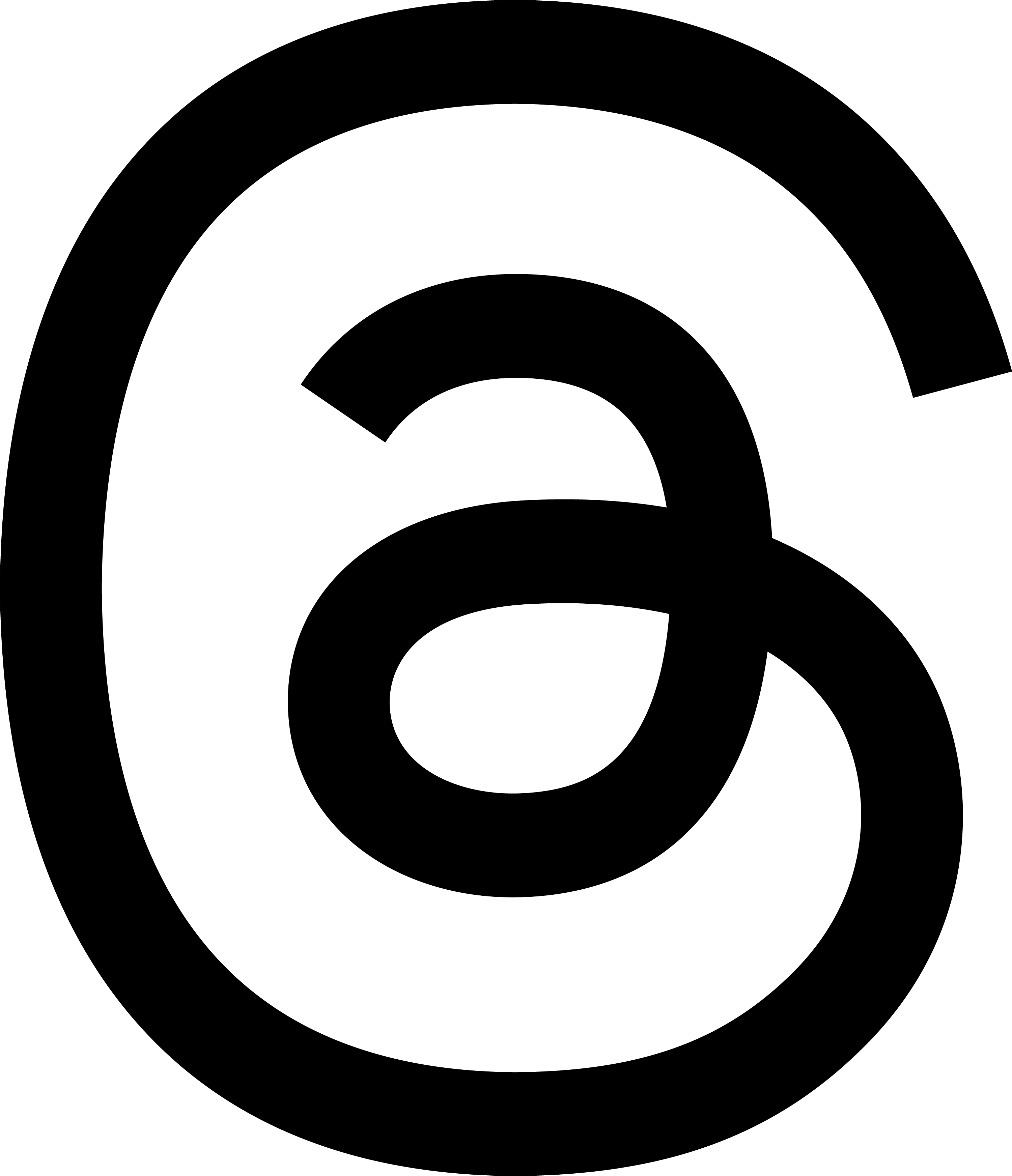Dr. Erkan Gürsoy begeisterte am 04. November 2025 rund 70 Lehramtsstudierende, Lehrende und Mitarbeitende der Universität Duisburg-Essen (UDE) mit seinem spannenden Vortrag „Ist Almanca wirklich difficult? – (postkoloniale) Sprachideologien und (Reproduktion von) Alltagsrassismus in der Monolingualisierung und Vermittlung des Deutschen“. Er sensibilisierte die Anwesenden für die Verflechtungen von Sprache, Macht und Rassismus – mit Fokus auf translinguale Praktiken, den nachhaltigen Erhalt von Migrationssprachen in Folgegenerationen und Vermittlungskontexte des Deutschen. Eingeladen hatte das Zentrum für Lehrkräftebildung (ZLB) der UDE.
Ist Deutsch schwer?
Erkan Gürsoy erläuterte zu Beginn, dass er mit dem translingual gewählten Titel bewusst einen Bogen zwischen gelebter Mehrsprachigkeit und hegemonialen Sprachanforderungen spanne. Auf die Frage „Ist Almanca wirklich difficult?“ ließen sich recht schnell Antworten finden, wenn Deutsch nicht nur als einzelsprachliches System betrachtet werde: Ja, Deutsch sei aus Lernendenperspektive schwierig, wenn man es im Erwachsenenalter lerne, was für alle Sprachen gelte. Nein, Deutsch sei wie alle anderen Sprachen kinderleicht (im engeren Sinne!) zu erwerben. Und aus Lehrendenperspektive hänge das Gelingen von Sprachvermittlung von den eigenen professionellen und didaktischen Kompetenzen ab.
Aber worin ist die Aussage, der man so häufig begegnet, begründet, Deutsch sei eine schwere Sprache und inwiefern wird dadurch bis heute ein kolonial geprägtes Bild von Deutsch(land) reproduziert? Erkan Gürsoy griff monolingual(isierend)e Normen und koloniale Kontinuitäten auf und zeigte, wie postkolonial Linguizismus – hier Alltagsrassismus im Kontext von Sprachlichkeit – auch in Bildungseinrichtungen reproduziert würde.
Sprachtypologie
Er ging auf das ideologische Nachwirken von Schlegels Sprachtypologie aus dem frühen 19. Jahrhundert zurück, reflektierte die Ursachen sprachliche Dominanzpraktiken, die oft subtiler wirkten als explizit rassistische Äußerungen, und argumentierte mit den Theorien von Gogolin und Bezug auf den Sprachlichen Habitus nach Bourdieu aus den 1980er Jahren. Dieser zeige, dass Sprache als soziale Praxis Prestige und Macht erzeuge, was zur Marginalisierung und Verdrängung von Varietäten oder (translingualen) Sprachvariationen führe. In unserem täglichen Umfeld sei eine Abwertung nicht deutscher Sprachen und innerdeutscher Sprachvariationen zu beobachten.
Abschließend stellte Erkan Gürsoy das Konzept des Languaging nach Garcia vor – Sprache sei ein dynamischer, sozialer Prozess des Bedeutens und Handelns – und lud die Anwesenden zur Teilnahme an der internationalen Abschlussveranstaltung des Projektes „Your Language Counts!“ am 22. und 23. Januar 2026 ein. Diese wird ausgerichtet vom Institut für fachorientierte Sprachbildung und Mehrsprachigkeit (IfSM) im Ressort Interdisziplinarität des ZLB an der UDE an den Campus Essen.
Erkan Gürsoy stellte in seinem Vortrag drei Perspektiven auf de-monolingualisierende Sprachvermittlung vor:
- Das BMBF-Projekt „Schreiben im Fachunterricht der Sekundarstufe I unter Einbeziehung des Türkischen (SchriFT)“: Das interdisziplinäre Vorhaben untersuchte, in welcher Weise Schüler*innen durch die gezielte Einübung von Schreibkompetenzen im Deutschen und im Türkischen bezüglich des fachlichen Lernens in Physik, Technik, Politik und Geschichte gefördert werden können.
- Das Programm „Koordiniertes Mehrsprachiges Lernen (KOALA)“: Dieses verfolgt einen Ansatz der Mehrsprachigkeitsdidaktik, der die Realisierung didaktischer Potenziale des Translanguaging im Unterricht ermöglicht. Durch die systematische Verzahnung von Regelunterricht und Herkunftssprachlichem Unterricht (HSU) sowie das Sichtbarmachen aller Sprachen einer Klasse wird die metasprachliche Bewusstheit aller Lernenden geschult, mehrsprachig-inklusives Lernen begünstigt und der Spracherwerbsprozess mehrsprachiger Schüler*innen erleichtert.
- Den Universitären Förderunterricht, kurz FU, der an der UDE an der Fakultät für Geisteswissenschaften im Institut als Zweit- und Fremdsprache am Campus Essen in Kooperation mit einer Vielzahl von Essener Schulen durchgeführt wird: Im Förderunterricht werden Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund ab der 6. Klasse von (Lehramts-)Studierenden in den Räumlichkeiten der Hochschule betreut und gefördert. Der FU sei ein Raum für mehrsprachigkeitssensible Praxis für LA-Studierende jenseits hegemonialer Sprachanforderungen.
Hintergrundinformation zur ZLB-Vortragsreihe Bildung für Toleranz
Im Mai 2025 jährte sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Die aktuellen politischen Debatten und der „Rechtsruck“, insbesondere der jungen Wählerschaft, befördern vor diesem Hintergrund auch die Auseinandersetzung mit Themen wie Extremismus, Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus. Das teilweise junge Alter der Akteur*innen verdeutlicht, wie wichtig die Rolle der Schulen als ein zentraler Ort ist, um antidemokratischen Tendenzen präventiv zu begegnen. Für die Aufgabe, diskursive Präventionsarbeit an Schulen zu leisten, müssen angehende Lehrkräfte sensibilisiert und mit den notwendigen didaktischen und ethischen Handlungskompetenzen ausgestattet werden.
Vor diesem Hintergrund bietet DiversiTeach in Kooperation mit dem Basic und Advanced Training (BuAT) – beides Projekte des ZLB – die Vortragsreihe Bildung für Toleranz an, die mit dem Vortrag von Erkan Gürsoy im Wintersemester fortgesetzt wurde.
Zur Person:
Dr. Erkan Gürsoy ist seit Januar 2023 Geschäftsführer des Instituts für fachorientierte Sprachbildung und Mehrsprachigkeit (IfSM) im Ressort Interdisziplinarität des ZLB an der UDE und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Im Jahr 2024 vertrat er die Professur für Mehrsprachigkeit in der Schule an der Bergischen Universität Wuppertal und leitete von 2016 bis 2023 das Modellprojekt „ProDaZ“. Aktuell leitet er die Drittmittelprojekte HSU-Interregio (BMBF), Pluri-KO (MSB) und Your language counts! (Erasmus+). Im Jahr 2020 wurde er mit dem Diversity Preis der UDE für seine Forschung ausgezeichnet. Seine Forschungsschwerpunkte sind Migrationspädagogische und mehrsprachigkeitsdidaktische Perspektiven auf den sogenannten „Herkunftssprachenunterricht“, nachhaltigen Erhalt von Migrationssprachen sowie translingualen Sprachpraktiken und fachorientierte Sprachenbildung.