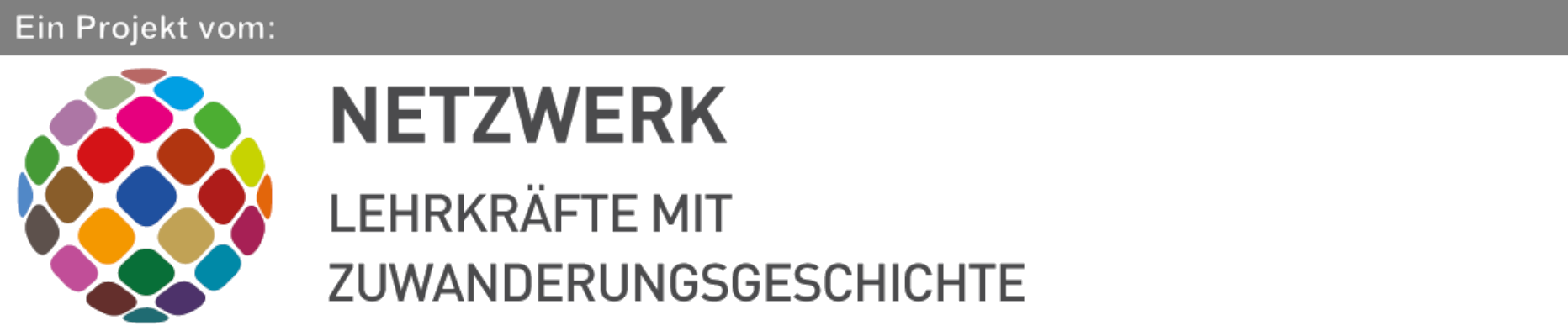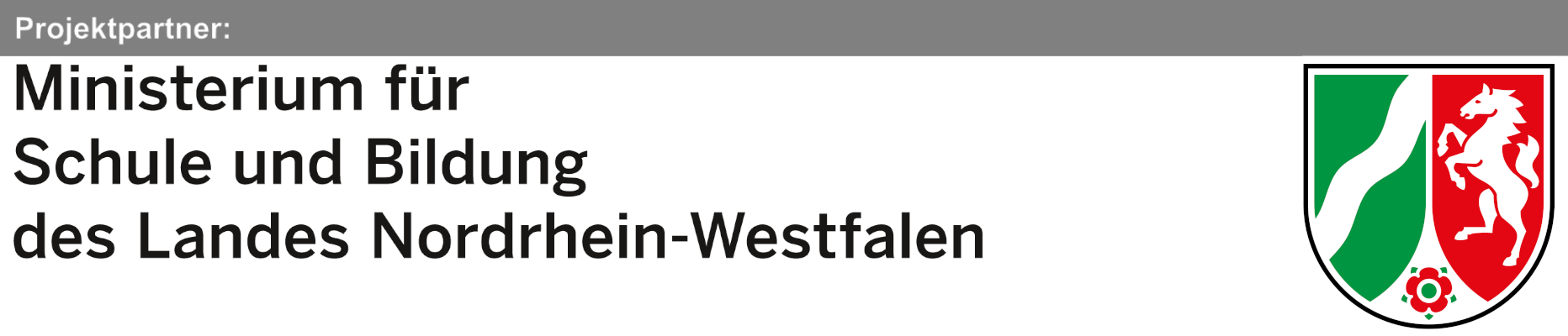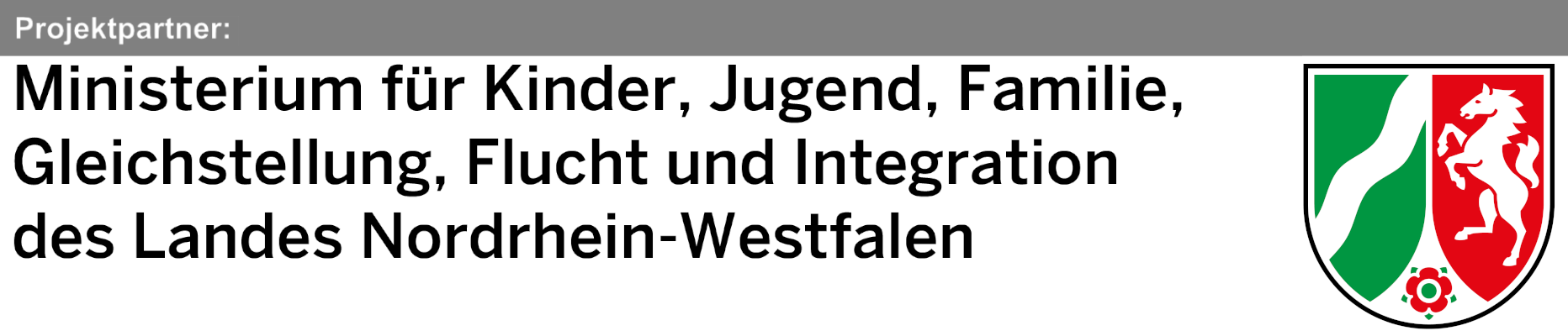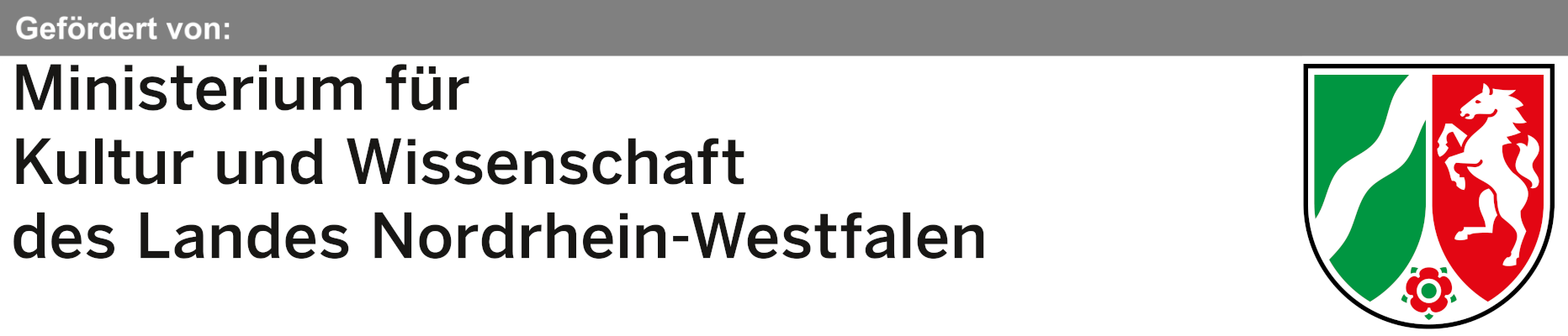Ziele des Projekts DiversiTeach sind:
Lehramtsstudierende für migrationspädagogische und diversitätsbewusste Fragestellungen und Herausforderungen im Bereich Schule und Unterricht zu sensibilisieren, die Themen Diversität und Migration für Schulen in der Migrationsgesellschaft nachhaltig in der Lehrkräftebildung zu etablieren.
Wir bieten im Rahmen von DiversiTeach studienbegleitende Workshops und Vorträge für Lehramtsstudierende der UDE – mit und ohne Migrationshintergrund an. Die Teilnahme an den Angeboten ist kostenfrei. Die Workshops können zudem für die Gesamtbescheinigung über den Erwerb von Schlüsselqualifikationen im Lehramt im BuAT angerechnet werden.
DiversiTeach wird vom Netzwerk für Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte koordiniert und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert. Im Zentrum für Lehrkräftebildung (ZLB) ist das Projekt direkt der Geschäftsführung des ZLB zugeordnet und ein Kooperationspartner des Basic und Advanced Trainings (BuAT).
Termine
ZLB-Vortragsreihe „Bildung für Toleranz“
Aktuelle politische Debatten und der Rechtsruck, auch bei Jungwähler*innen, machen die Auseinandersetzung mit Extremismus, Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus notwendig. Schulen spielen dabei eine zentrale Rolle. Um angehende Lehrkräfte zu sensibilisieren und mit den notwendigen didaktischen und ethischen Handlungskompetenzen auszustatten, bietet das Projekt DiversiTeach in Kooperation mit dem Basic und Advanced Training (BuAT) die Veranstaltungsreihe „Bildung für Toleranz“ an.
Expert*innen unterschiedlicher Disziplinen werden in Gesprächen und Diskussionen mit angehenden Lehrkräften erarbeiten, wie sie antidemokratische Phänomene im Unterricht thematisieren und einordnen können sowie durch kritische Reflexion demokratisches Handeln in ihrer Schülerschaft stärken können.
Mit dieser Veranstaltungsreihe sollen Räume und Gelegenheiten für differenzierte und faktenbasierte Debatten geschaffen werden, die die Handlungssicherheit der Lehramtsstudierenden in einem hochkomplexen Wirkungsfeld fördern und dazu beitragen, Schulen zu Orten der Demokratieförderung zu machen.
„Bildung für Toleranz“ ist ein extracurriculares Angebot für Lehramtsstudierende der UDE, das sie sich für die Gesamtbescheinigung im Basic und Advanced Training ( https://zlb.uni-due.de/buat ) / DiversiTeach (https://zlb.uni-due.de/veranstaltungen/diversiteach ) an der UDE anrechnen lassen können.
Anmeldung
Die Anmeldung zu den einzelnen Angeboten der Vortragsreihe erfolgt via E-Mail an ![]() {at}
{at}![]() (.)
(.)![]() .
.
Das Programm im Sommersemester 2026:
DiversiTeach-Theaterformat: „Neue Schule – neue Regeln? Spielend sicher in Konfliktsituationen agieren“ (im BuAT anrechenbar)
Dienstag, 27. Februar 2026, 10:00 bis 13:00 Uhr
Janna Plate (Künstlerische Leitung am Forumtheater Ruhr, Theaterpädagogin) und weitere Schauspieler*innen
Inhaltskommentar:
Als angehende Lehrkraft – auch als zugewanderte Lehrkraft, die im Herkunftsland fertig ausgebildet ist und bereits Unterrichtserfahrung mitbringt – stehst du in deiner Rolle besonders im Fokus: im Klassenzimmer, im Lehrerzimmer und auch bei Elterngesprächen. Häufig entsteht das Gefühl von Hilflosigkeit oder des Sich-Verteidigen-Müssens und anstelle einer Auflösung des Konfliktes verhärten sich die Fronten.
- Wie gehe ich mit herausfordernden Situationen im Unterricht um?
- Was kann ich tun, wenn der Unterricht kippt, ich mich überfordert fühle oder diskriminierende Kommentare erlebe?
- Wie lassen sich Missverständnisse und Konflikte im Kollegium konstruktiv klären?
Anhand von dialogischen, realitätsnahen Szenen aus dem Schulalltag schauen wir gemeinsam hin und klären auch die Fragen:
- Was passiert hier eigentlich?
- Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich?
- Und wie kann ich in herausfordernden Situationen handlungsfähig bleiben?
Szene 1: Eine Unterrichtssituation eskaliert: die Lehrkraft gerät unter Druck, erlebt Überforderung und wird mit diskriminierenden Äußerungen konfrontiert.
Szene 2: Herausforderungen im Lehrerzimmer: Missverständnisse in der Kommunikation unter Kolleg*innen, führen zu Irritationen und Konflikten.
Im Mittelpunkt dieses theaterpädagogischen Angebots stehen Austausch, gemeinsames Ausprobieren und Reflexion. Ziel ist es, Sicherheit im Handeln zu gewinnen, Selbstwirksamkeit zu stärken und neue Perspektiven für Kommunikation und Unterricht jenseits von Frontalunterricht kennenzulernen.
Wann?
Dienstag, 27. Februar 2026, 10:00 bis 13:00 Uhr
Wo?
Weststadttürme, Berliner Platz 6-8 | WST-C.d12. | 45127 Essen
Kosten?
Für Lehramtsstudierende kostenfrei
Sichere dir jetzt deine Teilnahme über  {at}
{at} (.)
(.) !
!
DiversiTeach-Workshop in der Alten Synagoge Essen: „Direkte und indirekte Antisemitismus-Prävention im schulischen Kontext“ (im BuAT anrechenbar)
Dienstag, 28. April 2026, 13:00 – 17:00 Uhr
Jürko Ufert ist Referent für antisemitismuskritische Bildungsarbeit im Schulwesen. Er arbeitet in Abordnung durch das Ministerium für Schule und Bildung (MSB NRW) bei SABRA (Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus). Er ist zuständig für den Austausch mit und die Sensibilisierung/Qualifizierung von Multiplikator*innen und Kooperationspartner*innen.
Dr. Anton Hieke koordiniert die mobile Bildungsarbeit der Alten Synagoge Essen, Haus jüdischer Kultur. Hierfür führt er altersunabhängige Formate zu den vielfältigen jüdischen Traditionen durch, um einen Einblick darin zu erhalten.
Inhaltskommentar:
Teil I: SABRA – Kompetent und konsequent gegen Antisemitismus im schulischen Kontext
Antisemitismus ist ein Problem, dem sich die Schulen als Spiegel der Gesellschaft stellen müssen. Jüdische Schüler*innen erfahren Antisemitismus in der ganzen Bandbreite seiner Erscheinungsformen. Die Institution Schule ist als Bildungs- und Erziehungseinrichtung verpflichtet, Antisemitismus zu bekämpfen. Antisemitismus ist keine bloße Meinung, sondern ein Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Diese zu schützen ist Aufgabe aller, vor allem aber der Lehrkräfte.
In diesem Workshop wird die Tätigkeit der Servicestelle für Antidiskriminierungsarbeit, Beratung bei Rassismus und Antisemitismus (SABRA) vorgestellt. Deshalb steht die Frage „Was tun bei antisemitischen Vorfällen im schulischen Kontext?“ im Mittelpunkt.
Bei der Beantwortung wird zunächst ein Blick auf Antisemitismus speziell im Schulbereich geworfen, bevor es um die schulrechtlichen Rahmenbedingungen in NRW geht. Es folgt die für SABRA besonders wichtige Auseinandersetzung mit den jüdischen Perspektiven auf Antisemitismus. An diese vorwiegend theoretische Analyse schließt die Vorstellung hauptsächlich an der Praxis orientierter, konkreter Handlungsempfehlungen für Schulleitungen und Lehrkräfte bei antisemitischen Vorfällen an. Der praktische Teil mündet schließlich in eine kritische Reflexion anhand von Fallbeispielen aus dem SABRA-Beratungsalltag und mithilfe der SABRA-Matrix zur gesamtspezifischen Arbeit von Schule gegen Antisemitismus.
Ein Angebot von SABRA
Teil II: Judentum und Judentümer und NRW
Die jüdischen Traditionen werden oft nur unter der Erfahrung der Verfolgung, des Antisemitismus und einer scheinbaren Andersartigkeit wahrgenommen. Sie sind viel mehr als das und ein Teil der Tradition der ganzen Gesellschaft. Als älteste noch heute existierende monotheistische Religion entwickelte sich das Judentum über die vergangenen Jahrtausende in eine Vielzahl von Judentümer und Traditionen. Was sind jedoch diese Traditionen unserer allgemeinen Tradition?
In diesem Teil der zweiteiligen Reihe geht es um Synagogen und Feiertage, Grundideen, Alltag und säkulare Welt. Natürlich sprechen wir auch über die Judentümer in Essen seit Napoleon. Wir sprechen auch über die moderne Darstellung der jüdischen Traditionen im Unterricht.
Ein Angebot der Alten Synagoge Essen.
Wann?
Dienstag, 28. April 2026, 13:00 – 17:00 Uhr
Wo?
Alte Synagoge Essen
Kosten?
Für Lehramtsstudierende kostenfrei
Sichere dir jetzt deine Teilnahme über  {at}
{at} (.)
(.) !
!
DiversiTeach-Workshop: „Jüdische Objekte zum Anfassen: Eine Einführung in die Welt der Judaica“ (im BuAT anrechenbar)
Freitg, 08. Mai 2026, 10:00 – 11:30 Uhr
Dr. Anton Hieke koordiniert die mobile Bildungsarbeit der Alten Synagoge Essen, Haus jüdischer Kultur. Hierfür führt er altersunabhängige Formate zu den vielfältigen jüdischen Traditionen durch, um einen Einblick darin zu erhalten.
Inhaltskommentar:
Mehr noch als ihr christliches Gegenstück werden in der jüdischen Religion und Tradition, ob in der Synagoge oder im eigenen Haushalt, eine Vielzahl an besonderen Gegenständen für die einzelnen Feiertage oder den Alltag verwendet. Wie sehen diese Gegenstände aus, was wird damit gemacht? Lassen Sie uns sprechen über Menora und Chanukkia, Torarolle und Jad, Schofar, Hawdala-Zubehör, Mesusa und einigem mehr. Die Einführungsveranstaltung stellt diese Gegenstände der jüdischen Tradition, ihre Verwendung und ihre Bedeutung vor.
Wann?
Freitg, 08. Mai 2026, 10:00 – 11:30 Uhr
Wo?
Weststadttürme, Berliner Platz 6-8 | WST-C.12. | 45127 Essen
Kosten?
Für Lehramtsstudierende kostenfrei
Sichere dir jetzt deine Teilnahme über  {at}
{at} (.)
(.) !
!
Das Programm im Wintersemester 2025:
„Das ist Wasser und keine Pfeife – Politische Bildung gegen Verschwörungsdenken im Unterricht“
(Bibliothekssaal am Campus Essen) – verschoben auf 2026 – Termin wird bekannt gegeben
Dienstag, 21. Oktober 2025, 16:00 bis 18:00 Uhr
Christoph Hövel, Bildungsreferent im Salvador-Allende-Haus
Inhaltskommentar:
Verschwörungsdenken gilt gemeinhin als faktenfremd. Wenn die Anhänger*innen einer Verschwörungsideologie nur dazu gebracht werden könnten, die wahren Fak-ten anzuerkennen, wäre der Bann gebrochen. Die Schule als Vermittlungsinstanz von gesichertem Wissen scheint hierzu der ideale Ort zu sein. Der Vortrag möchte diese Vorstellung irritieren und eine andere Haltung zum Verschwörungsdenken aufzeigen. Daraus ergeben sich andere Handlungsoptionen im Unterricht und eine gelungenere Prävention, die nicht erst dort ansetzt, wo eine Schüler*in sich bereits in die Zirkularität der Verschwörungsideologie verliert und diese ggf. mit menschen-feindlichen Weltbildern ergänzt.
Wann?
Dienstag, 21. Oktober 2025, 16:00 bis 18:00 Uhr
Wo?
Bibliothekssaal Campus Essen
Kosten?
Für Lehramtsstudierende kostenfrei